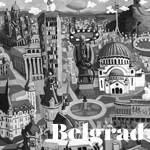 Natürlich bin ich nicht wirklich weg im Sinne von »weg«, aber seit einem halben Jahr steht mein Lehrerpult bekanntlich nicht mehr in Niedersachsen, sondern in Serbien. Mein Job hier nennt sich „Landesprogrammlehrkraft“ und umfasst unterschiedlichste Aspekte, die – soviel sei vorweggenommen – nahezu allesamt faszinierend sind. Warum der Dienst im Ausland eine Erfahrung fürs Leben ist, möchte ich wenig näher ausführen, indem ich die häufigsten und die grundlegendsten Fragen schriftlich abarbeite.
Natürlich bin ich nicht wirklich weg im Sinne von »weg«, aber seit einem halben Jahr steht mein Lehrerpult bekanntlich nicht mehr in Niedersachsen, sondern in Serbien. Mein Job hier nennt sich „Landesprogrammlehrkraft“ und umfasst unterschiedlichste Aspekte, die – soviel sei vorweggenommen – nahezu allesamt faszinierend sind. Warum der Dienst im Ausland eine Erfahrung fürs Leben ist, möchte ich wenig näher ausführen, indem ich die häufigsten und die grundlegendsten Fragen schriftlich abarbeite.
F: Wie kommt man ins Ausland?
A: Es gibt unterschiedliche Wege, deren Details man unter den Stichwörtern »Auslandsdienstlehrkraft« (ALDK), »Ortslehrkraft« (OLK), »Bundesprogrammlehrkraft« (BPLK) und eben »Landesprogrammlehrkraft« (LPLK) bei der Suchmaschine seines Vertrauens erfragen kann. Wir Landesprogrammlehrkräfte unterstehen weiterhin dem Kultusministerium unseres Bundeslandes – bei mir also Niedersachsen –, werden aber über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) ins Ausland vermittelt. Im Regelfall arbeiten wir nicht an Deutschen Schulen im Ausland, sondern an einheimischen Schulen, die außerdem bevorzugt in Ländern liegen, in denen Deutsch eine wichtige Rolle als Fremdsprache spielt – also vor allem östlich dessen, was die Älteren von uns noch als »Eisernen Vorhang« kennen gelernt haben. Ob es dann eher Warschau oder Wladiwostok wird, hängt sowohl von Wunsch als auch von Bedarf ab.
F: Und was macht man dann in Warschau, Wladiwostok oder Belgrad?
A: Im Wesentlichen übernehmen wir an unseren neuen Schulen die Rolle des Muttersprachlers im Deutsch-(als Fremdsprache = »DaF«)-Unterricht, springen aber, je nach studierter Fachkombination und Bedarf vor Ort, auch im bilingualen Unterricht für Geschichte, Kunst oder sogar Informatik ein. Im Deutschunterricht versorgen wir unsere Kollegen und Schüler mit muttersprachlichen Äußerungen, helfen bei einer Einschätzung, was »man« als Deutscher sagen würde oder sorgen für Authentizität bei Aspekten der Landeskunde. Klingt vielleicht ein wenig klinisch und unspezifisch, also Butter bei die Fische. Ich erkläre im Alltag: Wo liegt der Unterschied zwischen den Formulierungen »Ich möchte den Kuchen probieren« und »Ich möchte den Kuchen kosten«? Oder: Warum gebe ich bei Übungen zu Geschäftsbriefen eine »IBAN« an und nicht mehr meine Kontonummer und Bankleitzahl, obwohl das im Lehrbuch steht? Last but not least bereiten wir Lerngruppen ganz besonders auf das DSD vor.
F: Was ist dieses DSD?
A: DSD steht für »Deutsches Sprachdiplom« und derer gibt es zwei. Grundsätzlich darf man sich das DSD als den deutschen Cousin von DELF, DELE oder TOEFL vorstellen: Es zertifiziert Sprachkenntnisse auf einem bestimmten Level. Das DSD 1 auf dem Level A2 oder B1, das DSD 2 hingegen auf dem Level B2 oder C1. C1 ist gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen – auch wenn es natürlich einen Akzent haben darf – Deutsch auf einem Niveau, das qua Grammatik und Wortschatz einem Muttersprachler entspricht. Die Tests dafür sind standardisiert und testen sowohl das Verständnis (Hörverstehen und Leseverstehen) als auch die eigene Sprachproduktion ab (Schriftliche und Mündliche Kommunikation).
F: Und das machst du jetzt in Belgrad, also Serbien?
A: Ja. DSD 1 und 2 am hiesigen Filološka Gimnazija, DSD 1 zusätzlich am I., IX. und XIV. Gymnasium. Ich lerne also unterschiedliche Schülerschaften, unterschiedliche Schulen mit ihren Eigenheiten, teils auch dem jeweiligen Kollegium und Lernklima kennen. Das ist durchaus faszinierend. Außerdem bin ich – insbesondere nach serbischem Recht und Gesetz – mehr Coach als Lehrer. Ich gebe keine Noten und stelle keine Klausuren, sondern bin voll und ganz dafür da, meine Schülerinnen und Schüler mit möglichst guten Deutschkenntnissen und einem möglichst breiten Wissen über Deutschland als Staat und Gesellschaft auszustatten.
F: Aber ist Belgrad nicht so ein bisschen… ich meine, ist es gefährlich dort?
A: Nur wenn man im Zugwind steht, denn promaja ist tödlich! Scherz beiseite: Statistisch ist Belgrad sicherer als Stockholm.
F: Und ist da noch Krieg?
A: Nein. Und mich erschreckt ehrlicherweise mehr als nur ein wenig, dass mir diese Frage tatsächlich gestellt wurde. Ich hoffe immer noch, sie war ironisch gemeint und ich habe lediglich diese Ironie übersehen. Insofern, in aller Deutlichkeit: Ich habe mich ganz bewusst für diese Stadt, damit auch gegen andere Angebote wie das sibirische Perm oder Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam entschieden, weil ich Belgrad für einen der spannendsten Orte auf unserem schönen Kontinent halte.
F: Also ist alles super dort?
A: Kommt drauf an, was man »super« nennen will. Natürlich sehe ich, dass viele Gebäude in Belgrad ein paar Liter Farbe brauchen könnten; auch Bestände des hiesigen ÖPNV haben schon in vordemokratischen Zeiten Dienst getan und keuchen mittlerweile etwas asthmatisch die Hügel der Altstadt hinauf. Jugendarbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Lage allgemein und die entsprechenden Konsequenzen dieser Gemengelage sind ebenso ein sehr reales Problem im Alltag und nicht einmal – wie in der Bundesrepublik bisweilen der Fall – eine Folge mangelnder oder gar zu realitätsferner Ausbildung bzw. Anspruchshaltung. Nicht zuletzt würde ich all meinen hart arbeitenden einheimischen Kollegen mindestens eine Verdopplung, wenn nicht gar eine Verdreifachung ihres Lehrergehalts wünschen. Ich bin also durchaus nicht blind für die Probleme, mit denen Serbien, wie jede Transitionsökonomie in Ost‑, Mittelost‑, und Südosteuropa zu kämpfen hat. Trotzdem lebe ich gerne hier.
F: Warum? Was macht diesen Dienst so großartig?
A: Ich bin an einer ganz anderen Schnittstelle von Schülern und Unterricht tätig und gewinne Einblick in unterschiedliche schulische, nennen wir es mal: Ökosysteme. Als in Serbien lebender Ausländer erhalte ich gleichzeitig Einblick in eine andere Gesellschaft, ihre Wünsche, Nöte, Probleme, Sehnsüchte – ihr Leben. Das wiederum verändert meinen Blick auf die Bundesrepublik; ich merke tagtäglich, wie wenig ich einen ja zweifellos vorhandenen Hang zu Unzufriedenheit in Deutschland nachvollziehen kann. Ich lerne ferner jeden Tag Serbisch dazu, was ich vor Dienstantritt nur rudimentär radebrechen konnte. Grundsätzlich kann man diesen ganzen Aufenthalt auf zweierlei Weise analysieren und bewerten: Auf der objektiven Ebene reden wir deutschen Geschichtslehrer immer vom »Perspektivwechsel«, den wir unseren Lerngruppen abverlangen. Ich lebe hier einen solchen Perspektivwechsel. Andererseits gibt es die persönliche Perspektive: Ich wäre gerne schon im Studium, ehrlicherweise sogar schon als Elftklässler ins Ausland gegangen. Meist war das aber so illusorisch, dass ich gar nicht darüber gesprochen habe. Die Tatsache, dass ich nun nicht nur Auslandserfahrung sammeln, sondern diese auch noch mit meinem Beruf verbinden kann, finde ich umwerfend! Ich hätte diesen Dienst auch in Tiflis oder Taschkent angetreten, aber Belgrad war für mich das i‑Tüpfelchen: Ich kenne und mag die Stadt, habe Freunde und Bekannte hier, die mir den Umzug, die Eingewöhnung, den Alltag ungemein vereinfacht haben.
F: Klingt, als würdest du dort bleiben.
A: Klar. Das geht aber nicht für immer: Das »Programm« im Wort Landesprogrammlehrkraft sieht vor, dass wir unsere Jahresverträge maximal fünfmal verlängern dürfen, mit Ablauf des sechsten Jahres ist also die Rückkehr ins Schulsystem des Heimatbundeslandes verpflichtend. Mich hat das Kultusministerium in Hannover erst einmal bis Sommer 2018 freigestellt, ob ich dann bis 2019, 2020 oder maximal bis 2022 verlängere, werde ich jeweils ad hoc entscheiden.
